
Der
Knochen setzt verschiedene Stoffe in die Blutbahn frei, deren Konzentrationen
Aufschluß geben über den Zustand der aktiven Teile des Skeletts.
Man unterscheidet Neubildungs- und Abbaumarker, allerdings sind einige davon durch
beide Vorgänge beeinflußt und / oder für den Knochenstoffwechsel
nicht sehr spezifisch.
Als 'Marker' für
die Neubildung von Knochensubstanz gelten folgende - ausschließlich
im Blut(plasma) zu bestimmende - Peptidsubstanzen:
- knochenspezifische alkalische
Phosphatase (BALP = bone-specific alkaline phosphatase);
sie wird von Osteoblasten als zweite Stufe deren Reifung gebildet
und löst die Einlagerung von Kalziumphosphatkristallen aus,
vermutlich durch Abbau von (lösungs-stabilisierendem) Pyrophosphat.
- Osteokalzin; dieses
Vitamin-K-abhängige Protein bindet Kalzium, wird von reifen
Osteoblasten gebildet und in die Knochenmatrix eingelagert (15% der
neugebildeten Menge 'entweichen' in die Zirkulation und sind dort
nachweisbar). Osteokalzin wird allerdings auch beim Abbau des Knochens
wieder freigesetzt und gelangt (zu 70%) in den Kreislauf.
- Prokollagen-I-Propeptide ('Extensionspeptide')
- karboxy - und aminoterminal, abgekürzt PICP
und PINP - Bruchstücke
aus Kollagen-Vorläufermolekülen, von Osteoblasten während
ihrer ersten Reifungsstufe gebildet. Ihre Spezifität als Indikatoren
der Knochenbildung ist umstritten.
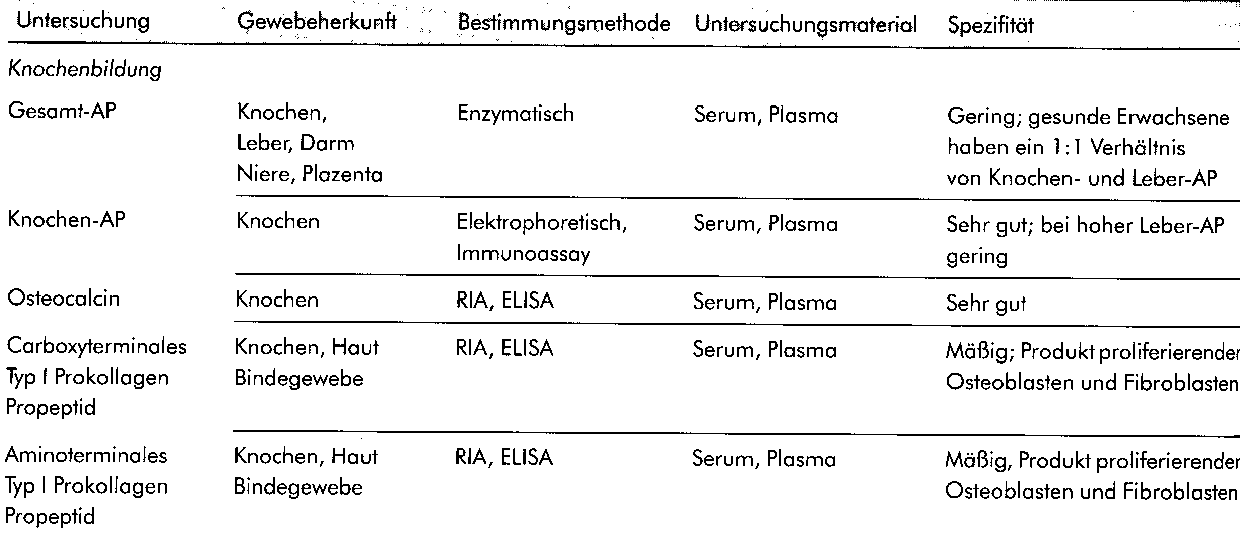
Tabelle aus: Kasperk /
Ziegler: Knochenstoffwechsel. In: Thomas (Hrsg.): Labor und Diagnose,
5. Auflage.
Für
die Abschätzung des Knochenabbaus können mehrere
Indikatoren herangezogen werden (teils deren Konzentration im Blutplasma,
teils die Ausscheidung mit dem Harn, s. Tabelle), von denen jedoch nur wenige
ausreichend spezifisch sind, wie die Desoxypyridinoline. Es handelt sich
um
- Hydroxyprolin (HYPRO),
aus dem Knochenkollagen zu rund 13% besteht; es fällt beim Knochenabbau
an und wird zu 90% abgebaut, zu 10% mit dem Harn ausgeschieden und
ist dort nachweisbar. Verschiedene Gründe schränken die
Spezifität als Resorptionsmarker stark ein.
- Pyridinolin-Querverbindungen:
Zusammen mit Desoxy-Pyridinolinen
ermöglichen sie die Stabilisierung reifen Kollagens und
Elastins (posttranslationale Bearbeitung von Lysin und Hydroxylysin).
Diese Querverbindungen fallen beim Knochenabbau an, und sie werden
zu 60% an Plasmaeiweiß gebunden, zu 40% in der Niere filtriert
und mit dem Harn ausgeschieden.
- Telopeptide: Während
der Resorption des Knochens erzeugen die Osteoklasten kleine C- und
N-terminale Kollagen-Bruchstücke ('CTX, NTX'),
die rasch über den Kreislauf in renale Tubuli und Harn
gelangen.
- Hydroxylysinglykoside:
Hydroxylysin ist eine kollagenspezifische modifizierte Aminosäure.
Die Galaktosylform wird wahrscheinlich nicht wiederverwendet und
kaum aus der Nahrung aufgenommen, sodaß sich diese Glykoside
als Resorptionsmarker eignen.
- Tartratresistente saure Phosphatase
(TRAP): Aus dem Knochen stammende saure Phosphatase - eine von 5
Isoformen (Knochen, Prostata, Plättchen, rote Blutkörperchen,
Milz) - erhält ihre Aktivität auch nach Behandlung mit
L(+)-Tartrat.
- Kalzium im Harn: Nachdem
Kalzium zu 99,9% im Knochensystem gespeichert wird, kommt es bei
Knochenabbau zu vermehrter Ausscheidung (etwa zur Hälfte mit
Harn und Stuhl). Die im Gastrointestinaltrakt resorbierte Kalziummenge
muß bei der Bilanz berücksichtigt werden.
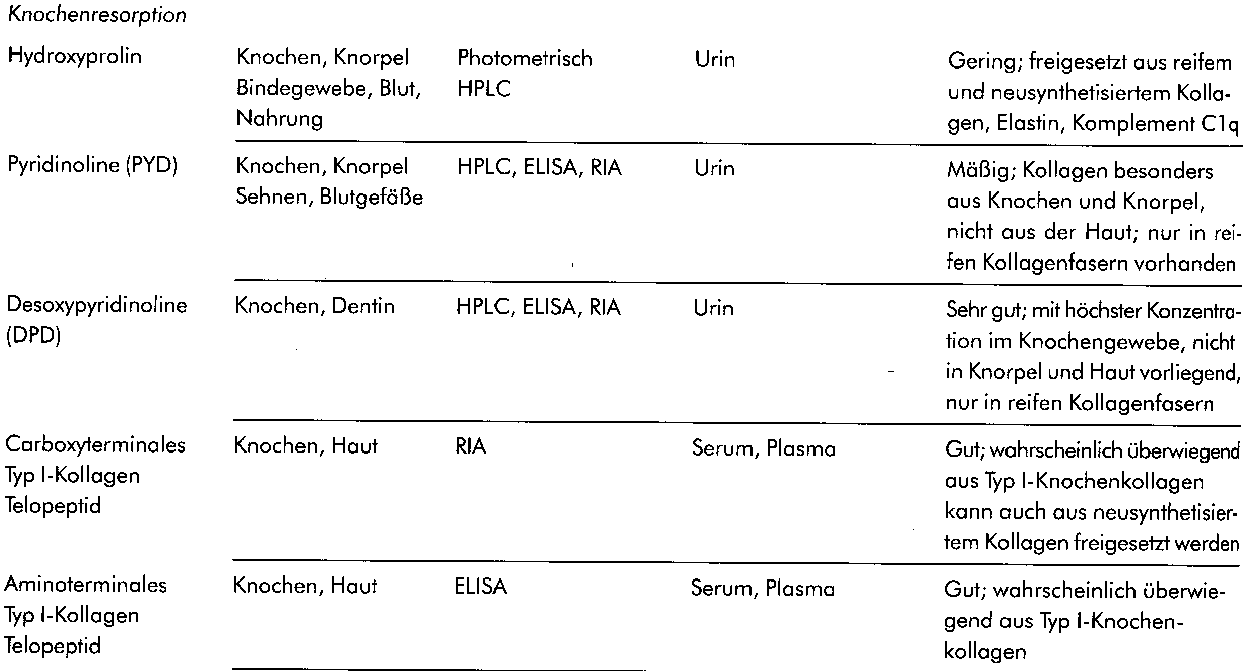
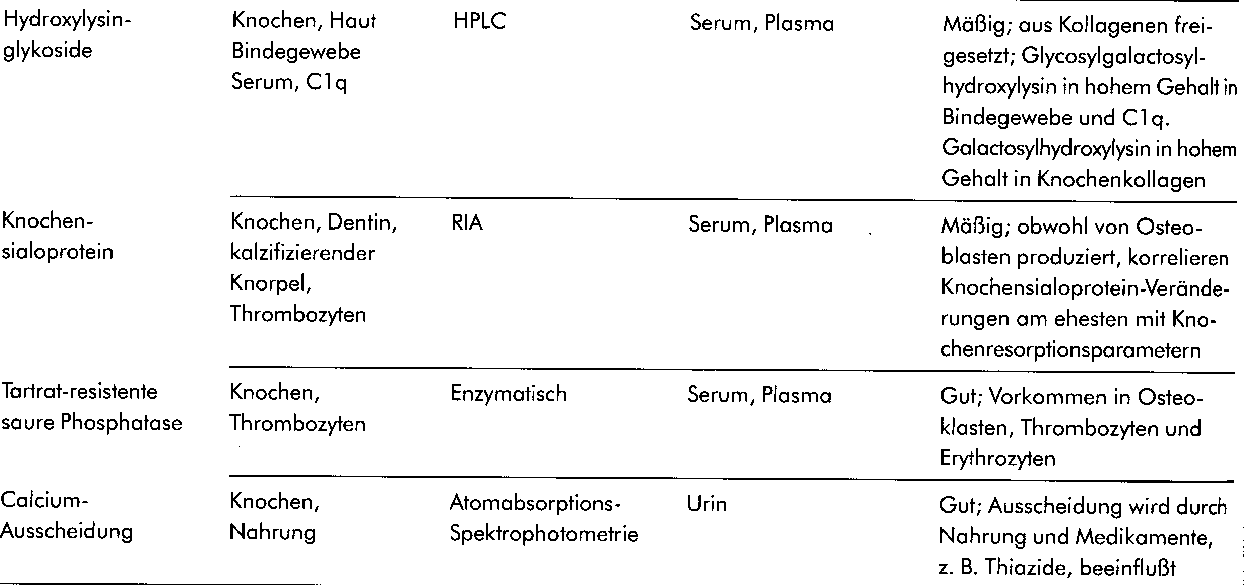
Tabelle aus: Kasperk /
Ziegler: Knochenstoffwechsel. In: Thomas (Hrsg.): Labor und Diagnose,
5. Auflage.


 Helmut
Hinghofer-Szalkay
Helmut
Hinghofer-Szalkay