
1915 beschrieb Bainbridge einen Anstieg der Herzfrequenz bei plötzlicher Vergrösserung des
Blutvolumens (Infusion von Kochsalzlösung oder Bluttransfusion).
Dieser Effekt war bei unterschiedlichem arteriellem Blutdruck
nachweisbar, aber von Dehnung des rechten Vorhofs (mit Steigerung
des zentralen Venendrucks) und intakter Nervenverbindung zum
Kreislaufzentrum (N. Vagus) abhängig.
Später wurde entdeckt, dass die
Reflexantwort von der Ausgangslage abhängt: Bei niedriger
Schlagzahl (Bradykardie) steigert Volumengabe die Herzfrequenz,
diese nimmt jedoch ab, wenn dasselbe bei hoher
Ausgangsfrequenz (Tachykardie) erfolgt. Wie ist das zu erklären?
Volumensteigerung (Infusion) erhöht
den Druck im rechten Vorhof. Das löst zwei antagonistische
Reflexmuster aus:
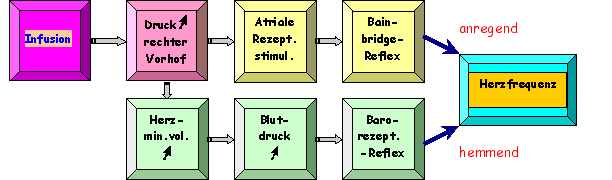
- Dehnung von Rezeptoren im Vorhof
regt über den Bainbridge-Reflex den Sinusknoten an und wirkt frequenzsteigernd.
- Der Starling-Mechanismus hebt aber
auch das Schlagvolumen und damit den (systolischen)
Blutdruck an - der Barorezeptorreflex hemmt dann den Sinusknoten und wirkt frequenzsenkend.
So ergibt sich ein doppelter
Rückkopplungskreis mit gegensätzlicher Frequenzwirkung. Welche
Wirkung überwiegt, hängt von der aktuellen Kreislaufsituation -
insbesondere dem Blutvolumen - ab:
- Bei geringem Blutvolumen (nach
Blutverlust) nimmt das Schlagvolumen mit Auffüllung des
Kreislaufs - in Richtung Normovolämie (Infusionstherapie!)
- zu und die Herzfrequenz gleichzeitig ab
(Barorezeptorreflex).
- Bei erhöhtem Blutvolumen
(Hypervolämie) hingegen bewirkt weitere
Volumensteigerung keinen Anstieg des Schlagvolumens mehr,
wohl aber Tachykardie (Bainbridge-Reflex). Dadurch
'versucht' das Herz das hohe Blutangebot über die
Schlagfrequenz 'abzuarbeiten'.
Die beiden Reflexe ergänzen einander,
sodass sie den Kreislauf in den optimalen Mittelbereich bringen.
 © Helmut
Hinghofer-Szalkay
© Helmut
Hinghofer-Szalkay


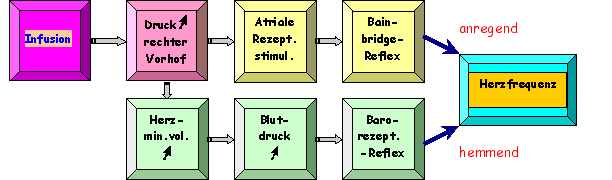
 © Helmut
Hinghofer-Szalkay
© Helmut
Hinghofer-Szalkay